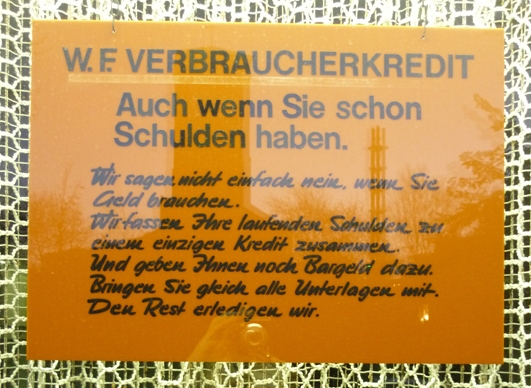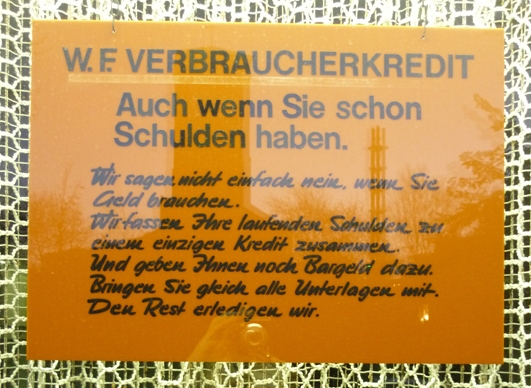7. bis 13. November 2011
Besprechungen vereinzelter Filme der 35. Duisburger Filmwoche von Daniel Neumann, Marie Falke und Christian Haardt.
Reaktionen, Kritiken, Ergänzungen bitte an: film@hfg-karlsruhe.de
Whores’ Glory von Michael Glawogger
Farben einer langen Nacht von Judith Zdesar
Aber das Wort Hund bellt ja nicht von Bernd Schoch


Whores’ Glory von Michael Glawogger
A 2011 | Farbe | 118 Min.
Arbeitswelten. Nach „Megacities“ und „Workingman´s Death“ führt uns Regisseur Michael Glawogger in „Whore´s Glory“ hautnah ans das älteste Gewerbe der Welt und zeichnet ein Triptychon - ein dreiteiliges Gemälde der Prostitution. Hautnah verfolgt der Film Prostituierte in Thailand, Bangladesch und Mexiko, erzählt Geschichten über das Verhältnis von Frau und Mann.
Frau: Im Bordell „Fish Tank“ in Bangkok sitzen die Prostituierten einem Aquarium gleich in einem hell erleuchteten Schaufenster. Sie tragen Nummern. Die Klienten sitzen im Dunkeln auf Sofas, begutachten das Angebot und holen sich Rat über die Qualität der Mädchen beim Zuhälter, der sehr zurückhaltend und höflich seine Gäste bewirtet. Höflichkeit trifft Geilheit.
Die Stadt der Freude ist ein Vergnügungsviertel in Faridpur, Bangladesch voller dunkler Gassen, wo sich Zimmer an Zimmer reihen. Sehr junge Prostituierte feilschen mit den Kunden um den Preis. Hier wird nicht nur gearbeitet, auch gelebt. Manch eine wird hier geboren und ist ein Leben lang Prostituierte, bis der Strom abgedreht wird, weil man keine Klienten mehr bekommt. Die Arbeit ist Notwendigkeit: Sex zu verkaufen, heißt überleben. Andererseits gibt es Stammkunden, und nicht auch ein bisschen Verliebtheit?
Eine Schranke trennt die Stadt Reynosa in Mexiko von „La Zona“, der Lustzone. Mit dem Auto können die Klienten - geile Jugendliche, einsame Männer, Vater und Söhne - direkt vor den Haustüren der Prostituierten in dieser Lustzone halten. Eine Verehrung der Santa Muerte, der heiligen Frau Tod, ist den Prostituierten in Tätowierungen auf den Leib geschrieben.
In Bangladesch gibt es ganz klare Tabus. Einem Freier einen zu blasen, widerspricht der Religion. Der Mund ist allein für die Suren des Koran. In Thailand reden zwei Prostituierte über ihre Präferenzen bei den Männern: Inder stinken und Afrikaner haben große Penisse. Man denkt über eine Fortbildung zur Masseuse nach. Das Geld reicht von vorne bis hinten nicht. So bitten sie im Gebet um viele Kunden. Nach der Arbeit zeigen die Prostituierten dann ihre Sehnsucht: Sie geben viel Geld aus, um Animateuren und Call-Boys zu gefallen. Prostitution ist ein Gewerbe. Doch der Film zeigt, dass hinter der Attraktion „Rotlicht“ Menschen mit Bedürfnissen, Ängsten und Zuneigungen sind.
Ruma arbeitet schon seit mehreren Jahren als Prostitutierte, in der Stadt der Freude ist sie aber neu. Eine der vielen „Mamas“, so könnte man die Zuhälterinnen dort nennen, nimmt sie für ein Jahr „unter Vertrag“. Ruma wird mit passender Kleidung ausgestattet, geschminkt und gepflegt und lernt von der Zuhälterin das Einmaleins der Branche. Sich als Prostituierte hier zu etablieren, ist schwierig und schon bald gibt es eifersüchtige Streitereien unter den Mädchen. In Reynosa erzählt eine Prostituierte von einem fettleibigen Mann, der sich in sie verliebt hatte und extra eine Schönheitsoperation durchführte. Nichtsdestotrotz verliebte sie sich nicht in ihn.
Mann: Die Klienten kommen mit dem Wunsch nach einem Mädchen, das für alles offen ist - im Gegensatz zur eigenen Ehefrau, die zwar die Nummer 1 bleibt, aber im Bett eben nicht mehr die Anforderungen erfüllt. In Mexiko geht eine Gruppe Jugendliche in die Zone, weil die Prostituierten es ganz besonders machen. Man darf sich wünschen, wie man Sex haben will. Ein Friseur aus Faridpur sagt, dass er mindestens ein bis zweimal am Tag in die Stadt der Freude geht, um sich zu „entladen“. Gäbe es dieses Viertel nicht, würden die Frauen auf der Straße von den Männern zerfetzt werden vor Geilheit. Ein Verkäufer auf dem Markt geht immer nur in die Stadt der Freude zu einem, zu seinem Mädchen, das wunderschöne Augen hat. Ein japanischer Tourist beklagt sich wegen der hohen Preise. Wer denkt an die Freier? Sie können ja nicht anders. Die Männer seien doch eigentlich die Ware für die Frauen. Für ihn scheint es vollkommen normal, dass er gegen Geld eine Zeit lang Recht auf den Körper der Prostituierten hat.
Am Ende des Filmes sieht man zum ersten Mal eine Sexszene. 200 Pesos für drei Stellungen, das ist eine Sonderkondition für den Kunden. Nach zwei lustlosen Stellungen ohne viel Gestöhne gibt es die obligatorische Ansage der Prostituierten: „Wenn du jetzt nicht kommst, ist das nicht mein Problem.“ Er kommt nicht, die Zeit ist um, und der Mann 200 Pesos ärmer. Zufrieden?
(Christian Haardt)
Aber das Wort Hund bellt ja nicht von Bernd Schoch
D 2011| Farbe | 48 Min. | Uraufführung
Das renommierte Freejazz-Trio unter Anführung von Alexander von Schlippenbach wurde von Bernd Schoch über eine Dauer von vier Jahren, immer während der Winterreise bei ihrem Konzert in Karlsruhe dokumentiert. Die Musik des Pianisten, Saxophonisten und Schlagzeuger ist zumeist eine Improvisation, die, oftmals bekannte Jazz-Themen variierend, zumindest für den ungeübten Hörer schwer nachzuvollziehen ist und sich in ihren eigenen Zusammenhängen nur an bestimmten Punkten erschließt, da sich die Musiker treffen um sogleich wieder in disparater Einzelarbeit auseinanderzugehen. Eine Dokumentation, die diese sich von einander entfernenden und wieder zueinander findenden Bögen zeigen will, muss deswegen zwangsläufig neben der Beziehung von Instrument, Ton und Bild auch einen Weg finden, die Performativität, wie sie sich in diesem Genre nicht zuletzt als Präsenz von Physis und Kraft der Körper ausnimmt, filmisch nachzuvollziehen.
So stellt „Aber das Wort Hund bellt ja nicht“ den Zuschauer vor ein semiotisches Problem, das schon der Titel selbst andeutet. Denn wie jenes Wort Hund nicht bellt, sondern nur auf den realen, bellenden Hund verweist, klingen nicht die Bilder selbst, sondern nur die Musik, die sie, die Spieler zeigend, vermittelt. Die Dokumentation versucht ebenjene Schnittstelle, an der die Aufnahmen die Musik fühlbar und nachvollziehbar machen, zu konzentrieren, bzw. zu essentialisieren. In drei Segmenten, die jeweils einem unterschiedlichen Konzert entnommen sind, verharrt eine Kamera ohne Schnitt auf jeweils einem der drei Musiker. Mit hoher Brennweite verengt sich der Kader auf ein Detail, eine Hand oder ein Gesichtsausdruck, und lässt den Rest des Bildes in Musik zergehen. Wenn dann etwa der Saxophonist zu sehen ist, lässt die Machart des Films den gewöhnlichen Kausalzusammenhang von einem Spieler, den man Spielen und so die Töne entstehen sieht, hinter sich, indem sie sein Gesicht isoliert, das nur frenetisch an dem Mundstück des Saxophons zerrt, sich aufbläst und schüttelt, während die Musik, die im Off sich vollzieht, immer schneller und wilder wird. Ebenso die Hände des Alexander von Schlippenbach, die, in einem Ausschnitt isoliert, ein Eigenleben gewinnen und so schnell über die Klaviatur huschen, dass sie kaum mehr sichtbar sind.
Der Film schafft es so eine Grenze zu berühren, die andere Konzertmitschnitte in ihren zahlreichen und beliebigen Zusammenstellungen multipler Kameraeinstellungen nicht mal andeuten können; nämlich die Grenze zwischen dem Bild, das zeigt und der Musik, die zu Hören ist. Ein Ton ist die reine Dauer, die sich in der Zeit entfaltet und dynamisch wird, sich so ständig selbst aufhebt und keine Demarkation bildet, die keine Arithmetisierung, oder mathematische Einteilung während des Hörens selbst erlaubt, es sei denn zum Preis ihrer Versteinerung. Eine Struktur in sich, die nicht so mit den Bildern korrespondieren kann, dass beide zusammenfallen, weil die Bilder, die die Erzeugung der Töne zeigen – sei es, indem sie die Instrumente abbilden, sei es, indem sie die Gesichter und Köpfe zeigen, die den Verlauf konzipieren – immer einen Anfang und ein Ende haben, die Zeit nicht musikalisch zusammenziehend, sondern in berechenbare Einheiten zerlegend; denn eben die Kopplung an die Materie, an das Feste, das seine Gestalt zwar verändert aber beharrt, lässt die Bilder immer diesseits der Musik bleiben. Die Intensität des Eindrucks muss deshalb noch immer am höchsten bleiben, wenn man die Augen schließt und die Aufnahmen, die das Geschehen Begleiten, Begründen und in einer ihm fremden Struktur anordnen, ausblendet, um sich ganz von der auditiven, in sich selbst geschlossenen Ebene, einnehmen zu lassen.
(Daniel Neumann)
Wie festgewachsen saß ich am Donnerstagabend in meinem Kinosessel, unfähig mich zu rühren. Grund war der Film „Aber das Wort Hund bellt ja nicht“ von Bernd Schoch, ein Film über den Free Jazz und das berühmte Schlippenbach Trio.?
Paul Lovens fliegende Hände am Schlagzeug, so schnell, dass man sie manchmal nur verschwommen sieht. Schlippenbach, der während eines Pianosolo stumm die Lippen bewegt, während ihm kleine Schweißperlen langsam die Stirn herunterlaufen. Parker am Saxophon. Virtuos spielt er mit geschlossenen Augen ohne innezuhalten, er atmet in sein Instrument, sein Gesicht scheint dabei völlig entspannt. Und schließlich der Klang des Free Jazz: frei, extrem, intensiv. Sei es meine eigene Liebe zur Musik oder der Film selbst, ich war gefesselt.?
Ohne Vorankündigung überraschte Regisseur Schoch eines Abends im Jahre 2007 das renommierte Schlippenbach Trio im Karlsruher Jazz Club mit der Bitte, er wolle einen Film über sie machen. Drei Jahre vergingen, jeweils drei Konzerte innerhalb von drei Jahren wurden begleitet. Entstanden ist ein technisch minimalistisch gehaltener, ästhetischer, intensiver Film, der den Zuschauer sowohl zum Zusehen als auch zum Zuhören drängt.?
Der Film ist in vier Teile fragmentiert, wobei jeweils auf jeden einzelnen Musiker und letztlich auf das Zusammenspiel der drei zusammen Wert gelegt wird. Schoch verzichtet auf viele Schnitte, bereichert den Film mit kleinen Interviews der einzelnen Musiker, was ihm eine immense Intensität gibt und auch von typischen Bandreportagen unterscheidet. Was hier zählt, das sind die Musiker und ihre Musik.?
Nach dem Film wurde diskutiert. Manch einer war der Meinung Bild und Ton könne man hier nicht vereinbaren, ein anderer war völlig euphorisch, er habe sich dem Free Jazz niemals mehr verbunden gefühlt, wieder ein anderer sagte, er habe mit den Augen hören können. Die Meinungen gingen da auseinander, doch der Konsens blieb: Dieser Film sei ein Unikat, das es so wahrscheinlich nicht noch einmal gibt.?
(Marie Falke)
Wie festgewachsen saß ich am Donnerstagabend in meinem Kinosessel, unfähig mich zu rühren. Grund war der Film „Aber das Wort Hund bellt ja nicht“ von Bernd Schoch, ein Film über den Free Jazz und das berühmte Schlippenbach Trio.?
Paul Lovens fliegende Hände am Schlagzeug, so schnell, dass man sie manchmal nur verschwommen sieht. Schlippenbach, der während eines Pianosolo stumm die Lippen bewegt, während ihm kleine Schweißperlen langsam die Stirn herunterlaufen. Parker am Saxophon. Virtuos spielt er mit geschlossenen Augen ohne innezuhalten, er atmet in sein Instrument, sein Gesicht scheint dabei völlig entspannt. Und schließlich der Klang des Free Jazz: frei, extrem, intensiv. Sei es meine eigene Liebe zur Musik oder der Film selbst, ich war gefesselt.?
Ohne Vorankündigung überraschte Regisseur Schoch eines Abends im Jahre 2007 das renommierte Schlippenbach Trio im Karlsruher Jazz Club mit der Bitte, er wolle einen Film über sie machen. Drei Jahre vergingen, jeweils drei Konzerte innerhalb von drei Jahren wurden begleitet. Entstanden ist ein technisch minimalistisch gehaltener, ästhetischer, intensiver Film, der den Zuschauer sowohl zum Zusehen als auch zum Zuhören drängt.?
Der Film ist in vier Teile fragmentiert, wobei jeweils auf jeden einzelnen Musiker und letztlich auf das Zusammenspiel der drei zusammen Wert gelegt wird. Schoch verzichtet auf viele Schnitte, bereichert den Film mit kleinen Interviews der einzelnen Musiker, was ihm eine immense Intensität gibt und auch von typischen Bandreportagen unterscheidet. Was hier zählt, das sind die Musiker und ihre Musik.?
Nach dem Film wurde diskutiert. Manch einer war der Meinung Bild und Ton könne man hier nicht vereinbaren, ein anderer war völlig euphorisch, er habe sich dem Free Jazz niemals mehr verbunden gefühlt, wieder ein anderer sagte, er habe mit den Augen hören können. Die Meinungen gingen da auseinander, doch der Konsens blieb: Dieser Film sei ein Unikat, das es so wahrscheinlich nicht noch einmal gibt.?
(Marie Falke)
Sonnensystem von Thomas Heise
D 2011 | Farbe | 100 Min.
Ein Traktor ist samt seines Anhängers an einer Böschung umgekippt. Ein dramatischer Moment in dem Dorf Tinkunaku. Einige Männer schaufeln den Zement von der Straße. Eine Frau rettet das restliche Benzin aus dem Tank des Traktors. Im Hintergrund stehen unbeteiligte Dorfbewohner. Gemeinsam versucht man mit Seilen und Ketten den umgefallenen Traktor wieder aufzurichten.
In ruhigen totalen Bildern, ja Gemälden, fängt der Film „Sonnensystem“ von Thomas Heise das Alltagsleben in der indigenen Dorfgemeinschaft von Tinkunaku ein. In dieser bergigen Gegend Argentiniens definiert allein das Licht die Zeit, die raue Natur lenkt das Leben. Sobald die Sonne aufgegangen ist, beginnt man zu arbeiten: Der bis zu den Knöcheln in weicher, matschiger Erde stehende Mann gräbt den Lehm für die Ziegelsteine um. Ein Junge mahlt Maiskörner mit einem Mahlstein zu Mehl. Auf der Weide werden die Kühe zusammen getrieben. Ein Ochse wird unter großer Gegenwehr festgebunden. Es führt zu nichts, er lässt die schmerzvolle Kastration und Brandmarkung über sich ergehen. Man will wegschauen.
Die Klänge der Alphorn-ähnlichen Instrumente läuten das Ende der Arbeit ein. Es beginnt der Festumzug. Die Bewohner der Dorfgemeinschaft haben sich verkleidet. Sie tragen Masken und spielen mit ihren Spritzpistolen. Im Dorfladen geht Bier für Bier über den Ladentisch.
Die Natur ist gewaltig. Wenn es gewittert, aus Strömen regnet, wenn die Sonne brennt. Im Winter wie im Sommer. So wird der Natur gedankt. Eine Kuh wird auf den Boden gezerrt, die Messer werden gewetzt. Mutter Erde wird mit Blättern und Alkohol begossen. Die Kuh röchelt ihrem langsamen Tod entgegen. Schicht für Schicht arbeitet sich die ganze Familie an dem Kuhleib ab.
Ab und zu gibt es Strom in Tinkunaku. Dann sitzen die Kinder vor dem Fernseher mit großen Augen und offenen Mündern, und gucken in eine andere Welt. Ob diese Kinder den selben Tätigkeiten wie ihren Vätern nachgehen werden, bleibt spätestens nach dem letzten Bild des Filmes fragwürdig: Man befindet sich nicht mehr in der Dorfgemeinschaft, sondern fährt an Slums vorbei, im Hintergrund tauchen langsam Hochhäuser auf. Alles wirkt dreckig und schäbig, irreal wie in einem Traum. Eine Frau singt „Lacrimosa - Dies irae“, Tag der Tränen, Tag der Wehen. Man steigt über die Slums hinweg, die Skyline taucht auf. Eine Eisenbahnlinie trennt die Hochhäuser von den unverputzten Häusern der Slumgebiete. Lose Brückenpfeiler stehen unverbunden zwischen den Häusern.
(Christian Haardt)
Farben einer langen Nacht von Judith Zdesar
A 2011 | Farbe | 70 Min. | Deutsche Erstaufführung
Von einem Applaus begleitet geht langsam die Sonne unter. Gefilmt über den Wolken aus dem Fenster eines Flugzeugs auf dem Weg nach Grönland ist dies die erste Einstellung des Films, dessen orangener Vorhang fällt, dass der Film beginnen kann.
Duch ein ‘Artists in Residence’ Angebot war es der Regisseurin möglich, einen Monat lang in Upper Narvik, einer kleinen Insel mit ca. 1000 Einwohnern zu verbringen. Fast ununterbrochen durch Schnitte setzt sich die Reise vom Flugzeug zum Ferienhaus durch verschneite Straßen fort, durch die Einfamilienhaussiedlung, deren anonyme, baukastenartige Fassade in der Schneelandschaft deplatziert, wie zum Trotz gegen die unwirtliche Natur dahingesetzt wurde.
Zwischen den subjektiven intimen Passagen, die die Protagonisten allein in ihrem Haus oder bei Spaziergängen durch die Umgebung aufnimmt, gibt es Gespräche mit ein paar Familien, deren Inuit-Dialekt das gebrochene Englisch auf markante Weise färbt. Themen der Unterhaltung scheinen zufällig: Von der Gefahr der niemals im Film auftauchenden Eisbären über Familienführung bis zu dem Verlust von geliebten Menschen entfaltet sich wohl weder ein homogenes Tagebuchprojekt, wie es der selbstbezügliche Anfang andeutet, noch ein Porträt über eine Gemeinde am Ende der Welt. Wenn es eine Thematik gibt, die die disparaten, anscheinend immer aus Spontaneität festgehaltenen Eindrücke zusammenhält, ist es die Angst vor dem unsichtbar Lauerndem, der Negativität oder Leere.
Schulkinder, die sich vor Geistern, vielleicht noch mehr vor einer übersinnlichen Präsenz fürchten und als Kontrapunkt die Erwachsenen, die solche unwohlen Gefühle nur noch positiv in die Gefahr durch Eisbären ausgelagert haben oder ihr Verhältnis zu Verstorbenen auf irgendeine Weise affirmieren können. Schließlich die Protagonistin selbst, die in den lyrischen Einstellungen von wippenden Eisschollen im Dämmerlicht ihre eigene Angst projiziert, sie jedoch ebenso von der unorganischen Natur aufgehoben findet.
Die abgetrennte, eingeschlossene Existenz in der eisigen Umgebung, Angst, Aberglaube und Negation jener Gefühle, die die Insel anscheinend unvermeidbar hervorruft, stehen so am Ende des Films in dem Raum, der, ganz von Dunkelheit umgeben, doch durch die Neugier von Julie Zdesar zum Leuchten gebracht wird.
(Daniel Neumann)
(Daniel Neumann)
Way of Passion von Joerg Burger
A 2011 | Farbe | 89 Min. | Deutsche Erstaufführung
Wer sich stattliche italienische Männer in Tränen aufgelöst, einander in den Armen liegend
anschauen will, der ist in Joerg Burgers “Way of Passion“ genau richtig.
Burger begleitet das sizilianische Dorf Trapani bei den Vorbereitungen und während der
Prozession des heiligen Karfreitags. Hierbei bedarf es keinerlei Erklärungen eines Erzählers, die Bilder sprechen für sich: Kantige, schwarze Anzüge tragende Italiener mit protziger Uhr tragen mit verbissenem Blick und unter höchster Anstrengung und Hingabe Altare, auf denen die
Hinrichtung und Auferstehung Jesu in verschiedenen Situationen in Szene gesetzt ist. Das Blasorchester, langsam hintertrottend, spielt immerwährend die gleiche dramatische
Melodie. Kaugummikauende, gelangweilt dreinblickende Teenie-Mädchen, laufen als
Engel verkleidet hinterher, ein Priester betet mit den schaulustigen Bürgern.
Man könnte meinen, Burger drehe eher eine Komödie als einen Dokumentarfilm. Und man fragt sich, ist das nun Glaube oder Ritual? Ernst oder Spaß? Feier oder Trauertag? Auf jeden Fall ist es ein sehr besonderer Tag für die Sizilianer, der gebührend gefeiert werden will, so trägt jeder seinen Teil dazu bei, sei es bei den Vorbereitungen oder der Prozession selbst. Letzten Endes endet sie in der Kirche, wo die Altare unter großem Beifall und vielen Tränen der tapferen Träger zurückgebracht werden.
Und schließlich versteht man den Spruch: „Eine Prozession in Sizilien ist wie eine
Beerdigung im Zirkus“.
(Marie Falke)
Abendland von Nikolaus Geyrhalter
A 2011 | Farbe | 90 Min.
Nüchtern zeigt das Bild eine Reihe von billig verfertigten Holzsärgen. Zwei Männer in Arbeitsanzügen schieben sie mittels einer automatischen Vorrichtung in die Verbrennungsöfen, erst seitlich aus einer Totalen, dann, um den Blick auf die Verbrennungsanlage freizugeben und so auch den letzten Zweifel, der sich aus der Nichtsichtbarkeit des ganzen Prozesses ergeben könnte, auszuräumen. Im nächsten Bild die schwarzen Urnen, die, in einem schlichten Metallregal nebeneinander abgestellt, den letzten Zug einer idiosynkratischen Biographie auslöschen. Das Abendland überlässt seine Toten einem industriellen Verwertungsprozess bei dem der letzte Rest Tradition nur als die Asche erscheint, die in gleichmäßigen Abständen in die Urnen fällt.
Oktoberfest. Von einer erhöhten Position aus filmt Geyrhalter die amorphe tanzende Menge und rahmt sie zu einem Tableaux des Exzess’, dem Bilder von Alkoholleichen aus der Notaufnahme nachgeliefert werden. Dazwischen ein langer Fußmarsch der Kamera durch die Massen, dern den befremdenden Eindruck durch die Nähe, in der der Blick zu einem untersuchend pathologischen wird, weitertreibt.
Diese Lesart ist nur eine Mögliche, jedoch eine, die „Abendland“ in seinen Betrachtungen von stumpfer Ekstase, Grenzschutz, Geriatrie und Abschiebungsgesprächen zu diktieren scheint – um so den Titel zu verdoppeln, bei dem es sich nicht nur um ein anderes Wort für Okzident handelt, sondern der, in Bildern, die durchwegs bei Nacht aufgenommen wurden, auch ein Land, einen Kontinent präsentieren will, das seinen Abend erreicht hat. „Abendland“ fliegt wie die Eule der Minerva bei Dämmerung los und erkennt in der Reihe kritischer Ansichten die Dekadenz, Exklusivität und die mechanische Verwaltung, in die sich Europa hineinmanövriert hat.
Dieser pessimistische Interpretationsansatz ist dabei nicht nur eine Konsequenz, die sich aus den Einstellungen erschließt, sondern folgt schon dem Leitgedanken, der sie alle in diesem Film vereint hat. Problematisch wird dabei ein Dokumentationsansatz, der in der bloßen Absicht schon seinen Sinn verteilt und die Bilder nur noch als Stellvertreter für seine Kritik ablaufen lässt. Diese folgen der Stringenz, indem sie starr und bewegungslos sich weigern, länger als ein paar Minuten ihrem Sujet beizuwohnen – ein Umstand, dem „Abendland“ seine komprimierte Machart verdankt. Schade ist dann, dass keinerlei dialektisches Spannungsverhältnis zwischen den Segmenten sich aufbaut, die Abwärtsspirale durch kein Einhalten unterbrochen wird, um sich nach den Zusammenhängen umzusehen, die ihre Determiniertheit zwar nicht relativieren, aber doch kontextualisieren könnte. So bleibt es ein Dokumentarfilm, der im einfachsten - bös: banalsten - Sinne, verpflichtet, Einzelvorgänge zu beobachten, die, als Akkumulation, gut mit der wegwerfenden Geste korrespondieren, die Geyrhalter selbst, auf den ostensiven Kulturpessimismus angesprochen, vollführt hat.
(Daniel Neumann)