34. Duisburger Filmwoche >>>
1. bis 7. November 2010
Die Reihenfolge der hier besprochenen Filme:
STERNE
HERR BERNER UND DIE WOLOKOLAMSKER CHAUSSEE
DAS SCHIFF DES TORJÄGERS
?DIE GROSSE ERBSCHAFT
CIGARETTA MON AMOUR
VON DER VERMÄHLUNG DES SALAMANDERS MIT DER GRÜNEN SCHLANGE
NACHTSCHICHTEN
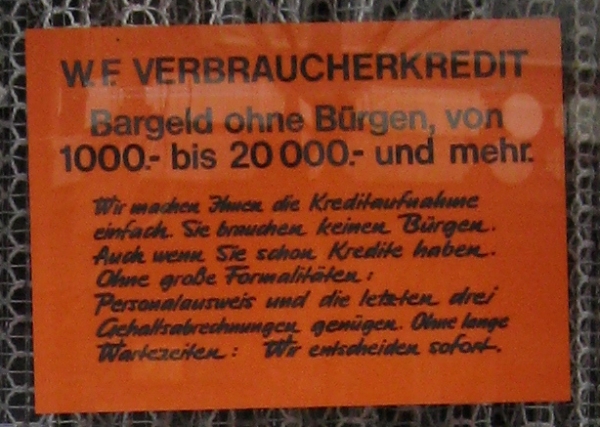
KLEINSTHEIM von Stefan Kolbe & Chris Wright
D 2010 | Farbe | 87 Min.
Die erste Aufnahme zeigt, ist Sarah. Sie steht da, uns gegenüber.
Auch sie nimmt uns auf. In ihr Zuhause, einem Kinderheim in der Magdeburger Börde, und in ihr Inneres. Dass sie Sarah heißt, werden wir erst später erfahren. Keine Einleitung zur Person, keine allmähliche Annäherung geht diesem Bild voran: wir sind plötzlich mit ihrem Dasein konfrontiert. Dass sie sich niedergeschlagen fühlt, sticht in die Augen. Neugier und Interesse stellt sich ein, ein Erfahrenwollen. Peu à peu wird es befriedigt, teilweise, in Lebensfragmenten: die verstorbene Mutter, die unhaltbare Beziehung zum Vater. Man schaut sie an und denkt an jene Lucy with the sun in her eyes. Das Mädchen mit den Kaleidoskop-Augen, in denen sich das abwechslungsreiche Leben spiegelt.
Auch andere Personen mit anderen Geschichten werden skizziert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die es nicht gibt. Adriano, Peggy, Kevin, Kai. So entsteht ein Mosaik von Menschen auf dem Weg zum Erwachsenwerden, auf dem die Hintergründe und Schwierigkeiten der Kindheit zwar immer noch präsent sind, aber langsam in die Vergangenheit entlassen werden. Adriano soll für eine Bewerbung ein Formular ausfüllen. Auf die Frage: „Deine Eltern, arbeitslos?“, antwortet er: „Ja, logisch!“. Vor diesen extrem vorsichtig unternommenen Porträts empfindet man nie Mitleid, nur Respekt vor der Entwicklung und Reife. Würde als Axiom, als notwendiger Samen, aus dem die Lebenskraft wachsen kann.
Die erwähnte erste Aufnahme wird nicht die einzige sein, aber auch keine Konstante: wie in jedem Leben bilden seine einzelnen Momente auch bei diesen Jugendlichen ein rasch wechselndes Helldunkel, eine Tragikkomödie. Oft erleben wir die Überwindung der Schwierigkeiten, das Streben nach einem besseren Ich. Eine Ausbildung abschließen, einen Job suchen, Verantwortungen übernehmen. Vermittelt wird dieses dank der zahlreichen Stellen, in denen sie draußen Sport treiben: Fußball, Seilspringen, Wandern. Die Energie fließt bei ihnen, auch was die Beziehung zu den Filmemachern angeht. Mit einer Ausnahme: Sarah lädt Chris (den Regisseur und Tonmann) und Stefan (Kamera) in ihr Zimmer ein. Sie macht die Tür zu und ruft ihren Vater an. Streit. Auflegen. Kein Interviews, hieß es. Hier brechen die Filmemacher ihre eigene Regel. Sarah provoziert: „Noch eine Frage?“, spöttisch. Das Vertrauen, das im Film herrscht, ist hier krumm.
Die Ausschnitte aus den einzelnen Schicksalen werden mit wunderschönen Bildern der Gegend interkaliert, die fast zu schön, zu ansichtskartenhaft wären, wenn sie nicht mit der Realität der inneren Räume kontrastieren würden: Bilder von Feldern, Bäumen, Dämmerungen, die vor allem auf die besondere Fruchtbarkeit der Natur an diesem Ort anspielen und die uns an Lebenszyklen, Kreise und Wiederholungen - oder Wieder-Erholungen - denken lassen.
In einer intimen Szene frisiert Sarah ihre Haare vor den Spiegeln, ihrem und dem der Kamera, und erzählt kokett von ihrer Mutter. „Ohne Hoffnung kann man diese Arbeit nicht machen“, meint einmal die Erzieherin. Sarah wird unsere Venus von Willendorf und gleichzeitig unsere Heldin, die uns von einer trotz allem doch hoffnungsvollen Zukunft träumen lässt.
(Laura Morcillo)
AUF TEUFEL KOMM RAUS von Mareille Klein & Julie Kreuzer
?D 2010 | Farbe | 82 Min.
Ein Garten voller Graugänse und ein Schild mit der Aufschrift: „Achtung Kinderschänder gleich rechts.“
Karl D., ein verurteilter Kindersexualstraftäter, der verdächtigt wird, nach seiner Haftentlassung erneut straffällig geworden zu sein, ist nach der Haft zu seinem Bruder Helmut D. nach Heinsberg gezogen. Jetzt wartet er auf das richterliche Urteil. Der Landrat hat Flugzettel verteilt und die Bevölkerung umgehend über den unliebsamen Nachbarn informiert. Seitdem ist Karl D. ein Medienereignis. Die Dorfbewohner demonstrieren, sie verlangen Sicherheitsverwahrung für Karl D.. Eine Puppe am Boden, dreckig und mit verrissener Unterwäsche, ziert die Demonstration.
Dann sehen wir Karl D.. Er steht mit einem Fernrohr hinter dem Fenster im Haus seines Bruders.
Karl D. Ist ein netter Mann. Er macht Hausaufgaben mit seinem Neffen und spielt hinter dem mit Planen verhangenen Zaun mit dem Hund. Schwer vorstellbar, dass dieser nette alte Mann all das getan haben soll.
Mit diesem Konflikt spielt dieser Film. Die Filmemacherinnen ergreifen bewusst nicht Partei für eine der Seiten, auch dem Zuschauer fällt es zunehmend schwerer.
Der Bruder Helmut wird interviewt. Er erzählt von der Schwierigkeit dieser täglichen Last. Er erzählt, man wolle ihm sein Kind wegnehmen, erzählt, dass das Haus beschmutzt wurde. Die Polizei, die täglich das Haus überwacht, schreitet nicht ein.
Helmut D. ist ein rechtschaffender Mann. Er hat Frau und Kind. Er will sich nur um seinen Bruder kümmern, der nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis kommt und niemand weiter hat. Nun sorgt er sich um den Zusammenhalt und die Sicherheit seiner Familie. Drohbriefe hat er bekommen. Die lauten Rufe der Demonstranten steigern sich. Aufgewühlt sucht er das Gespräch mit ihnen. Die Kamera muss ausgeschaltet werden.
Das nächste Bild zeigt Helmut D. im Krankenhaus. Er hatte einen Herzanfall.
Wir lernen eine Gruppe Frauen kennen, die zu den Demonstranten gehören. Sie erzählen vom Zusammenleben mit Karl D. in einer Stadt und von ihren Ängsten. Eine dieser Frauen wurde selbst einmal missbraucht. Sie erzählt von der Nacht, in der sie vergewaltigt wurde. Der Polizei hat sie es nie gemeldet. Sie ist nicht die einzige unter den Demonstranten mit persönlichem Bezug zu diesem Thema.
Im Laufe des Films äußern die Damen, dass ein großes Interesse besteht, in das Haus zu gehen und mit Helmut D. ein Gespräch abseits der Demonstration zu führen. Völlig irritierend ist die folgende Situation, in der die besagten Damen auf einmal tatsächlich zu Besuch bei Helmut und Klaus D. sind. Es gibt Kaffee und Kuchen, man unterhält sich sehr locker, auch über das Thema Vergewaltigung. Klaus D. gesteht ihnen seine erste Tat, für die er im Gefängnis saß.
In diesem Moment wird einem klar: der nette Mann ist tatsächlich ein Kinderschänder. Man fragt sich, warum die Frauen so entspannt dort sitzen.
Nach diesem Gespräch entschließen sich die Frauen, nicht mehr zu demonstrieren. Sie können sich nicht vorstellen, dass Karl D. noch einmal in der Lage wäre, ein Kind zu missbrauchen.
Sie besuchen Klaus D. nun öfter und ein neuer Disput entsteht, zwischen ihnen und den Demonstranten.
Klaus D. wurde nicht verurteilt. Sein Bruder will zusammen mit seiner Frau das Dorf verlassen um wieder normal leben zu können. Klaus D. wird erstmal bleiben.
(Rebecca Hirneise)
STERNE von Frank Wierke?
D 2010 | Farbe | 81 Min. | Uraufführung
In den 90er jahren gründete Frank Spilker zusammen mit Thomas Wenzel, Christoph Leich und Frank Will die Band „Die Sterne“. Sie wurden zu einem der bekanntesten Vertreter der Hamburger Schule, einer Punkbewegung die ihren Anfang und ihr Ende in diesem Jahrzehnt finden sollte. Heute sitzt der Sterne-Frontmann meistens am Laptop. Dort entstehen Texte und es werden Videotelefonate mit Produzenten geführt. Er wirkt mehr wie ein Geschäftsmann als ein Künstler. Etwas Neues schaffen, den Markt kennen, sich nicht wiederholen oder selbst kopieren. Es geht weniger um kreative Arbeit, mehr um Produktionsbedingungen und Imagepflege. Bei den Proben sehen wir eine Band, die ihre Musik bereits hinter sich gelassen zu haben scheint und keinen rechten Auftrieb mehr erleben will. Neu entwickelte Songs klingen müde und lustlos. Um ihnen das Adrenalin von früher zu verleihen, wird in der Nachbearbeitung die Geschwindigkeit angezogen – vergebens. Ein Techno-Produzent aus München soll die Gruppe aus ihrer Depression befreien, mit Synthie-Chören und gedoppelten „Snairs“. Der neue Einfluss spaltet die Gruppe. Der Keyboarder wird aus der Band entlassen.
Die Konzerte, bei denen wir die Band vom Rand der Bühne beobachten, lassen ein Zusammenspiel und die Lust daran fast vollständig vermissen. Der Live-Sound, der dort produziert wird, und den Regisseur Frank Wierke als ekstatisch und druckvoll beschreibt, zeigt erstens, dass der Band genau diese beiden Eigenschaften abhanden gekommen sind, und zweitens, dass der Filmemacher im Umgang mit kraftvoller Musik einiges nachzuholen hat. Als das Publikum eine Zugabe einfordert, sind wir mit der Band hinter der Bühne. Sie werden heute keinen Song mehr hören lassen. Aus Angst, sich zu verspielen.
Frank Spilker ist mit sich im Zwiegespräch. Nur durch eine „extreme, angewandte Schizophrenie“ lasse sich heute mit dem Musik-Machen wirklich Geld verdienen. Eigentlich dürfe man nur noch ein Album aufnehmen, wenn man wirkliche Lust dazu verspüre.
In der Podiums-Diskussion, die nach der Filmvorführung stattfindet, spricht der Bandleader von der Musikindustrie, einer „ganzen Branche, die den Bach runtergeht“. Der Film erzähle von diesem Prozess und zeige, dass auch eine Band, die seit 20 Jahren in diesem Musikgeschäft agiert, davon nicht unberührt bleibe. Jetzt sei die Gruppe auf der Suche nach dem neuen Sound und der Lust am Arbeiten. Große Hoffnungen darauf zu legen, dass die Suche erfolgreich endet, fällt nicht leicht.
(Robert Hamacher)
HERR BERNER UND DIE WOLOKOLAMSKER CHAUSSEE von Serpil Turhan
?D 2010 | s/w | 16mm | 39 Min. | Uraufführung
Vergessen und Vergessen und Vergessen.
Frontale Aufnahme. Schwarzweiß, 16mm-Film, Kratzer der Gebrechlichkeit. Ein alter Mann liest einen Text mit Hilfe einer Lupe. Wenn er nicht liest, erzählt er von seinem Leben. Seinem Tagesablauf, der Monotonie des Altersheims, seiner Vergangenheit. Das waren „gute Zeiten“.
Vergessen und Vergessen und Vergessen.
Herr Berner liest Heiner Müller. Stückweise tauchen persönlichen Gedanken auf, Erinnerungen von früher. „Genieße den Krieg, denn der Frieden wird grausam sein“, hieß es damals. Nach und nach erfahren wir, zusammen mit der Filmemacherin, dass er während des Krieges bei der Waffen-SS war. Geschossen hat er aber nie. Dass er dies wiederholt, gibt dem Zuschauer Grund zu zweifeln. Man redet über Reue: Nein, er bereut nichts. Höchstens, seine Wohnung verlassen zu haben. Das Altersheim gefällt ihm nicht.
In unregelmäßigen Intervallen hört das Bild auf, der Ton aber bleibt. Die Leinwand wird hier schwarz. In diesem Moment fühlt man sich wie im Panzer von Berners Gedächtnis: dunkel, abgesperrt, isoliert, aber immerhin geschützt.
Vergessen und Vergessen und Vergessen.
Was bleibt in der Erinnerung eines Menschen, der an undarstellbaren Zeiten teilgenommen hat.
Man könnte der Filmemacherin vorwerfen, der Film erzähle zu wenig. Und das stimmt, was die Fakten angeht. Anders als bei Claude Lanzmanns Art des Interviews, wird Herr Berner hier nicht zum Erzählen bestimmter Ereignisse aufgefordert. Wer einen investigativen Film erwartet, wird unabänderlich enttäuscht sein. Es wurden, im Gegensatz zu Marcel Ophüls Arbeiten, keine langen Recherchen im Vorfeld unternommen. Die gestellten Fragen wirken dadurch völlig unschuldig, gelegentlich naiv. Das schafft aber einen freien Raum, in dem er seinen fast inneren Monolog entfalten kann. Und wir assistieren in einem von Herrn Berner ausgesuchten Tempo der Erzählung, eine Reihe von Gedanken, die immer wiederkehren, die prekäre Konstruktion einer eigenen Geschichte, die ihm im Haufen seiner Erinnerungen ein wenig Ruhe bringen kann.
Die Behauptung des Dokumentarfilms als Ort der Geschichtsentdeckung. Ob das absichtlich oder zufällig geschieht, ist irrelevant. Für das Aufbrechen ins Ungewisse ist der Mut die beste Voraussetzung.
„Der Krieg hört nicht mehr auf. Wenn man ihn einmal erlebt hat, hört er nicht mehr auf“
Herr Berner stirbt 2010 im Frieden.
(Laura Morcillo)
Es ist ein 16mm-Film, Schwarz/Weiß. Viele Spratzer und Flecken. Ein älterer Herr versucht mit einer Lupe Heiner Müllers „Die Wolokolamsker Chaussee 1“ vom Blatt abzulesen. Wir sehen sein Gesicht nicht, er hält die Lupe und das Blatt davor. Der Ton ist im Gegensatz zum Film klar und deutlich aufgenommen. Der Mann selbst, Herr Berner, ist dennoch ohne Untertitel nicht zu verstehen. Er nuschelt mit Dialekt vor sich hin.
Er schweift ab vom Text, erzählt von seiner Vergangenheit. Es erscheint Schwarzbild. Wir hören ihm zu, die Konzentration liegt auf dem, was er sagt und vor allem, wie er es sagt. Langsam stellt sich heraus: Er war im Zweiten Weltkrieg. Er war in der Waffen-SS. Ein ihm damals gegebener Rat lässt ihn nicht mehr los: „Genieße den Krieg! Der Frieden wird grausam sein.“
Und in der Tat, er scheint dies wirklich so erlebt zu haben. Damals hatte er Geld und Beziehungen. Heute lebt er im Altersheim, ist arm und einsam. Wir sehen Bilder seines tristen Alltags dort. Seine Frau hat er verloren. Sie litt an Alzheimer. Er erzählt von seiner Laufbahn, wie er zur Waffen-SS kam und von seiner Zeit in Russland. Er war ein halbes Jahr in Kriegsgefangenschaft, eine kurze Zeit, wie er findet.
Die Regisseurin Serpil Turhan lässt ihn reden, fragt ab und an des Verständnisses oder der Genauigkeit halber nach. Er erzählt, er habe niemanden erschossen, habe kein KZ bewacht. Er fängt von sich aus an. Dann ergänzt er, er habe doch in einem Erschießungskommando seine Waffe auf Deserteure richten müssen. Keiner wusste jedoch in welchen Waffen sich die scharfe Munition befand. Er habe das damals machen müssen, Fahnenflüchtige mussten erschossen werden. Das sei „ein ganz logischer Vorgang“. Die Regisseurin hält sich ganz bewusst zurück, denn er redet von alleine weiter. Er wiederholt sich, geht immer wieder auf diesen Punkt ein, betont, er habe niemals jemanden erschossen. Er rechtfertigt sich, wo es von außen keinerlei Anklage gab.
Durch dieses Nicht-Eingreifen bleibt es dem Zuschauer selbst überlassen in kritischen Distanz das Gesehene und Gehörte zu bewerten. Denn schließlich demontiert Herr Berner sich selbst. Unverkennbar redet er sich seine Bewertung der Vergangenheit ein, es ist ihm unmöglich, diese zu hinterfragen.
Sie reden über den Tod und über Schuldgefühle. Reue sei nicht vorhanden. Er würde alles wieder so machen. Er stockt kurz, relativiert sich und hängt an, wahrscheinlich würde er alles wieder so machen.
Im Abspann wird noch einmal Herr Berners Werdegang und die nachweisliche Rolle seiner Waffen-SS-Einheit im Zweiten Weltkrieg dargelegt. Es fällt einem schwer, Herr Berner und seinen Beteuerungen zu glauben.
Es ist ein Film über Verdrängung. Eine sensible und offene Annäherung an dieses schwierige Thema.
(Nicolai Zeitler)
Ein alter, weißhaariger Mann sitzt in einer halbnahen Einstellung am Tisch und hält in der einen Hand ein Blatt, in der anderen eine Lupe. Aus dem Off die Stimme der Regisseurin: „Herr Berner?“ Er antwortet: „Wir können beginnen?“ Doch zuerst muss noch die Lupe, mit der er einen Text zu lesen versucht, gereinigt werden.
Bereits in den ersten Sekunden fällt die Oberflächenstruktur des Films, des schwarz-weißen 16mm-Materials auf: Kratzer und Flecken, stellenweise kurze Negativumkehrungen des Bildes, sowie kurze Lichtblitze prägen den ganzen Film hindurch dessen Optik. Wie wir aus dem Abspann erfahren können, ist dies einer Entwicklung des Filmmaterials per Hand und im Eimer zu verdanken. Das Auge gewöhnt sich sehr schnell daran.
Die formale Struktur des Films ist leicht zu erfassen. Her Berner erzählt, mal direkt in die Kamera, mal aus dem Off und gelegentlich unterbrochen von Fragen der Filmemacherin, aus seinem Leben.
Einstellungen von Herr Berner - seine faltigen Händen, angespannt und an zwei Fingern beringt, seine nicht erfassbaren Blicke in die Leere, sein langsames Fortbewegen durch das Zimmer in einen gemeinsamen Aufenthaltsraum des Heimes, Zigaretten rauchend - wechseln sich ab mit Detailaufnahmen des Raumes, in dem er sich befindet: Regale und Tischen mit Medikamenten, Tabletten, Bürsten, alles mit seinem Namen versehen. Eingerahmte Fotos, Portraits von sich, seiner Frau und Verwandten. Ein Fenster.
Dazwischen taucht immer wieder die Einstellung aus dem Prolog auf: Her Berner liest mit Hilfe der Lupe einen Text vor. Das Blatt bedeckt dabei vollständig seinen Mund (Dass es sich hier um einen Off-Ton handeln könnte, ist nicht auszuschließen). Durch die ebenfalls wiederholt eingesetzten Schwarzbilder, die eine vergleichbare Länge mit den übrigen Einstellungen haben, und in die der Off-Ton nahtlos übergeht, gewinnt der Film seine strenge Form.
Dass es sich bei dem Text um einen Teil der „Wolokolamsker Chausee“ von Heiner Müller handelt, kann einem Nichtkenner leicht entgehen. Auffallend sind jedoch die Parallelen zwischen dem Vorgelesenen und dem frei Erzählten: Unmittelbar nach dem Epilog sagt er, die Deutschen hätten den Hochmut der Sieger gehabt, ein Müller Zitat. Gegen Ende des Films macht Herr Berner eine ähnliche Aussage, die sich auf ihn selbst bezieht und wie ein Rahmen fungiert: „Ich bin halt ein bisschen überlegen.“
Herr Berners Stimme klingt rau, teilweise krächzend, und doch ist es die schwingende, raumfüllende Tiefe der Stimmlage, die sie unheimlich präsent erscheinen lässt.
Er denke viel an alte Zeiten zurück, an das, was man hätte besser machen können. Wir sehen die Einrichtung seines Zimmers und hören von seinem monotonen Tagesablauf im Altersheim, in dem er sich befindet. Dann betont er, wie schön er es im Krieg hatte. Eine Aussage, die er im Verlauf des Films öfters wiederholen wird.
Das faltige Gesicht Herr Berners,seine Augenbrauen verleihen dem Gesicht einen zwielichtige Ausdruck. Hinter ihm an der Wand hängt eine kindliche Zeichnung eines Mondes. Herr Berner sei bei einem Sonderkommando der SS gewesen, in dessen Hierarchie er durch seine Flexibilität und seiner Fähigkeit sich Anzupassen schnell aufgestiegen sei. Musterung in Karlsruhe, Ausbildung in Prag, Niederschlagung der Kavallerie von den Russen in Budapest und immer wieder: „Mir ging es gut während des Krieges. Ich kann mich nicht beklagen.“ Das Kennenlernen seiner Frau in Berlin, dazu das Portrait der Jungvermählten, ihre jungen Gesichter: Sie in Weiß, er in Uniform.
Herr Berner erinnert sich, aber seine Aussagen sind lückenhaft. Wir hören das leise Rattern der Filmkamera. Nach dem Krieg wollte er zurück in die Armee, was man ihm jedoch auf Grund seiner Vergangenheit verbot. Er betont, dass er zwar „ganz vorne an der Front“ gewesen sei, jedoch nie einen Schuss abgefeuert hat. Dann fällt ihm doch eine Geschichte von Fahnenflüchtlingen ein, die sie als Soldaten hinzurichten hatten: „Das ist ein ganz logischer Vorgang.“ Die tödlichen Schüsse seien aber nicht von ihm gekommen. Später erwähnt er noch einen weiteren, ungewollt abgefeuerten Schuss in eine Melone. Mit der KZ-Überwachung habe er nichts zu tun gehabt. Doch seine Aussagen bleiben immer zweifelhaft, passend zu den oft unscharfen Bildern der Kamera, die zwar unbeabsichtigt wirken, aber dennoch die verschleierte Identität des Porträtierten auch visuell markieren. „Nach dem Krieg sagen alle, keiner ist’s gewesen. Das ist das Traurige.“ Er erwägt, ob man vielleicht nicht hätte anders handeln sollen, da in seinem Kopf „der Kreis nicht mehr aufhört.“ Doch selbst die gegen Ende des Films immer häufiger gestellte Frage der Regisseurin, was er in seiner Vergangenheit anders hätte machen sollen, läuft ins Leere.
Man spricht über den Tod. Herr Berner sei 88 Jahre alt. Es hat keine Aufarbeitung, keine Reflexion über sein Verhalten während des Krieges stattgefunden: „Ich bereue nichts. Das liegt nicht drin.“ Es folgen Texttafeln, die seinen Karriereaufstieg in der NSDAP an konkreten Daten festmachen und eine „historisch korrekte“ Einschätzung der Verbrechen der Waffen-SS geben wollen.
(Iuri Maia Jost)
DAS SCHIFF DES TORJÄGERS von Heidi Specogna?
D/CH 2010 | Farbe | 91 Min.
„Du kannst kein guter Fußballer sein, wenn du deine Konzentration auf andere Dinge lenkst. Dann kannst du auch dein Geschäft nicht machen, und wenn du dein Geschäft nicht machen kannst, kannst du auch deine Familie nicht ernähren.“
Jonathan Akpoborie ist einmal ein erfolgreicher Bundesliga-Torjäger gewesen, er ist in Nigeria aufgewachsen. Mit langsamen Schritten betritt er das Stadiom in Wolfsburg, das immer noch seines ist, irgendwie. Hier hat er seine großen Erfolge gefeiert. Er gerät ins Träumen, seine Augen glänzen. Damals, im Spiel gegen Duisburg, da waren alle schlecht drauf, und doch wusste er, sie mussten siegen. Mit einem Kopfball erzielte er das Tor und seine Mannschaft gewann. Das Video habe er hunderte Male angesehen, er könne manchmal noch immer nicht glauben, dass er derjenige war, der dieses Tor köpfte. Er lächelt in die Ferne, im Hintergrund stehen die vielen leeren Bänke. Doch die Zeit, in der er hier wegging, sagt er, an die erinnert er sich nicht gern.
Umschnitt. TV Nachrichtensendung skandiert: Stürmer-Star Akpoborie soll als Schiffseigner in einen Kindersklavenhandel im Staat Benin verwickelt sein. Ihm droht das berufliche Aus. Die Brüder des VFB-Spielers hatten mit seinem zur Verfügung gestelltem Geld das Fährschiff „Etireno“ gekauft und mit den Einnahmen die Familie ernährt.
Der Stürmer kam früh von zu Hause weg. Damals, bevor er Profi war, füllten sie Nylonstrümpfe mit Papier, erzählt er seinem Sohn, mit dem er in seinem Wohnzimmer sitzt. Im Ghetto gab es kein Geld für einen echten Ball. Er streicht seiner Tochter über das fein geflochtene Haar. Sein altes Trikot hängt eingerahmt an der Wand, deutsche Zeitungsausschnitte zeigen ihn strahlend. Seine Mutter habe ihn früher immer verprügelt wenn er Fußball spielte, lacht er. Bis die Erfolge kamen, er für die ersten Spiele nach China reiste und nach vollem Erfolg vom ganzen Land umjubelt wurde. Sogar der Präsident kam, um ihm am Flughafen zu begrüßen.
Ortswechsel. Auf einem staubigen Acker vor einer ärmlichen Hütte steht ein junges Mädchen in traditioneller Kleidung. Sie sieht traurig aus, während sie von ihren Erinnerungen an Bord des Schiffes erzählt. Sie ist sehr klein gewesen damals und habe nicht gewusst was ein Schiff sei. Man habe ihr gesagt, es sei groß und sicher, es beschütze sie vor den riesigen Fischen im Meer, die einen Kamm auf dem Rücken hatten, um Menschen zu töten.
Sie habe dableiben wollen, bei ihrer Familie, sagt sie. Aber ihre Mutter hatte kein Geld, und sie sollte da in Gabun arbeiten und der Mutter Geld schicken. Sie war die jüngste, der Vater war vor kurzem gestorben. Gabun sei reich, hatten die anderen erzählt. Das Dorf veranstaltet eine Voodoo-Zeremonie für ihren Schutz auf der Reise.
Sie fragt sich, was wohl aus den anderen Kindern geworden sei die damals, vor 9 Jahren mit ihr an Bord waren.
Ein schlanker Junge sitzt am Meer. Von hinten würde man denken, er sei Erwachsen, so muskulös ist sein Rücken. Man habe ihn weggeschickt, weil er in Benin als Fischer arbeiten sollte. Er schweigt wieder. Der Vater zeigt sein Netz, es sei das wertvollste, was er besitze. Denn ohne das Netz könne er nicht fischen, und ohne Fische habe er nichts, um seine Familie zu ernähren. Das aber ist ohnehin sehr schwer. Das Geld für Bildung und Essen fehle, und drüben in Gabun hätte sein Sohn vielleicht eine Chance. Er lächelt schüchtern. Als Vater, fügt er hinzu, bekomme man Ansehen in der Gesellschaft.
Die Kinder, die verstreut leben, beginnen über die Tonaufnahmen der Interviews miteinander zu kommunizieren.
Ein Junge, etwas älter als das Mädchen, wird nun zum Fotografen ausgebildet. Sie schaut auf den Kassettenrecorder aus dem er spricht und hört aufmerksam zu.
„Vertraue nie wieder jemandem, der dich wegschicken will.“, tönt es daraus. Die Mutter sitzt auf einem Stuhl und scheint sehr erschöpft zu sein, niemand redet.
Der Junge erzählt. Die Reise war eigentlich für drei Tage geplant gewesen, und dafür sei auch der Proviant rationiert. Aber die Papiere der Kinder fehlten. Das Schiff musste an der Grenze umdrehen.
Der Kapitän steuerte vom Ufer weg. Ob er sich noch daran erinnere, fragt das Mädchen den Jungen. Dass sie ins Wasser springen sollten. Sie habe so eine große Angst gehabt. Als sie sich an Land retteten, wurden sie von Banditen überfallen. Überall standen Grenzer, die Kinder versuchten sich zu verstecken, wo sie nur konnten – vergeblich. Man nahm sie gefangen und schikanierte sie, schlug auf sie ein und zwang sie, über Stunden reglos zu knien. „Haut ab in euer Land“, schrieen sie. Die Kinder dachten, sie würden sterben.
Jonathan Akporobie fährt in seinem Vollautomatik-Auto über die Hauseinfahrt. Er hat von all dem nichts gewusst, sagt er. Er war in Deutschland und hat sich auf seinen Beruf konzentriert. Den Beruf, durch den er seine vier Brüder und seine Eltern ernähren konnte.
Deutschland sei ein schönes Land. Jeder wisse immer genau, was er zu tun habe, alles laufe nach Plan. Niemand macht etwas jenseits dessen, was getan werden muss. In Nigeria gehe man ständig über irgendwelche Grenzen.
Eine mechanische Stimme im Auto sagt die Uhrzeit an, Akpoborie tippt ein paar Knöpfe.
Als das Schiff die Grenze verlässt und ziellos auf dem Meer umher fährt gibt es einen medialen Aufschrei. Eine UNICEF-Sprecherin erzählt, wie lange man sich diese Reaktion erhofft habe. Endlich höre die Welt zu. Nach ein paar Tagen dann die Rettung der Kinder und Ihre Unterbringung in Notunterkünften. Die Brigade komme nun mehrmals in der Woche zu den Kindern, um sicherzugehen, dass man sich um sie kümmert. Überall im Land stehen Verkehrsschilder, dass man seine Kinder nicht alleine lassen darf.
Auf dem Eisenmarkt im Hafen Cotonou schlagen Kinder mit schweren Hammern auf Werkstoffe ein, ihre Motorik ist routiniert, sie arbeiten schnell und reden nicht dabei. In der Ferne schwanken Schiffe über das Meer. Noch immer werden Kinder in den Notunterkünften katalogisiert. „F“ steht da in der einen Spalte für das Geschlecht, in der nächsten Spalte steht ein „abuse“ mit einem Fragezeichen dahinter.
Der Junge am Meer erzählt, dass er seinem Vater nicht mehr vertraue, seitdem er verschickt wurde. Ihr Verhältnis sei kühl. Seit damals ertrage er die Nähe zum Meer nicht mehr, sein Leben sei Durcheinander, und die Lehre habe er geschmissen.
Das Mädchen will Krankenschwester werden, sie sei eine von Denen, die es zu etwas bringen werde, sagt sie und klingt stolz.
Jonathan Akporobie besucht das Arenal seiner alten Mannschaft. Hier sind die kleinen, 11-15 jährigen, erzählt Peter Pander, Manager des VfL Wolfburg und deutet auf eine Gruppe Jungen in Trikots.. Sie schlafen in kargen Zimmern und fahren Sonntags nach Hause. Hinter den Glastüren rennen Jungen auf Laufbändern und machen Liegestütze. Rein Wirtschaftlich gesehen, sagt Peter Pander, war es natürlich schlecht, den Stürmer damals zu verlieren. Man habe ihn ja ersetzen müssen und dafür große Summen zahlen müssen. Und die sportliche Leistung habe auch nicht wieder aufgewogen werden können.
Jonathan Akpoborie schweigt.
(Lene Vollhardt)
DIE GROSSE ERBSCHAFT von Fosco & Donetello Dubini
CH/D 2010 | Farbe | 90 Min.
8mm-Filmausschnitte. Erinnerungen einer Familie. Dann ist es Nacht, Autoscheinwerfer erhellen den dunklen Wald. Eine Person ist zu sehen, die dort etwas mit einer Taschenlampe zu suchen scheint.
Wir sehen ein Haus bei Nacht, das abwechselnd an verschiedenen Stellen beleuchtet wird. Durch einen Lichtstrahl, der sich langsam durch die Dunkelheit bewegt, erkennt man Gegenstände die sorgfältig auf einem Tisch arrangiert wurden. Eine alte Schlüssel, eine alte Waage, Notizbücher. Gegenstände an denen die Zeit nicht unsichtbar vorüberging.
In diesem Film der Brüder Fosco und Donatello Dubini, geht es um das Haus, in dem sie aufgewachsen sind, im Tessin in der italienischen Schweiz. Durch Brandstiftung ist das Haus eine Ruine und nun
kurz davor, abgerissen zu werden. Aus diesem Grund wollen die Brüder Dubini das Haus und seine Geschichte festhalten, konservieren, bevor es nicht mehr existiert.
Der erste Blick in das Haus zeigt den Treppenaufgang. Die Treppe ist mit alten Holzlatten bedeckt, dass man besser hochsteigen kann. Nach und nach sehen wir mehr von dem vom Feuer zerstörten Haus. Geschmolzene Glühbirnen im Kronleuchter, rußige Wände und Asche die zeigt, wo zuvor etwas stand. Liebevoll stellt der Kameramann Gegenstände an die Orte zurück, an denen sie vor dem Brand wohl gestanden haben.
Auf der Suche nach ihrer Geschichte erfahren die Brüder von längst vergessenen Geschichten. Nachbarschaftsstreitereien werden aufgedeckt und die Geschichte der familieneigenen Bäckerei erzählt.
Auf der Suche nach Wertsachen sucht einer der beiden mit einem Metalldetektor das Haus ab. Er scheitert kläglich. Die Ersparnisse sind nicht aus Metall sondern aus Papier.
Wiederholt wird der Abriss des Hauses zwischengeschnitten, bis es am Ende nicht mehr existiert. Als wäre es aus Pappe, erliegt das Haus der Kraft des Baggers.
(Rebecca Hirneise)
Die Filmemacher, die beiden Brüder Fosco und Donatello Dubini reisen ins Tessin in Südtirol. Ein dort leerstehendes Haus, von ihrem Großvater vor Jahrzehnten gekauft, ist vor kurzem komplett abgebrannt. Dies wird als Anlass genommen, sich ihrer Familiengeschichte zu nähern.
Erzählt wird in Kapiteln: Prolog, 1,2,3,4,5,6 und Epilog. Zu Beginn jeden Kapitels sehen wir den voranschreitenden Abriss des abgebrannten Hauses.
Im Off-Text, von einer Frau gesprochen, wird das Haus als Verkörperung der Familiengeschichte dargestellt. Die Regisseure betreten mit der Handkamera das zerbrechliche abgebrannte Gebilde mit den morschen Treppen, bewegen sich immer tiefer in das Haus hinein.
Dazwischen erleben wir den Versuch, das Haus und die Geschichte der Familie zu rekonstruieren. Der Vater der Regisseure lässt das Leben mit deren Großvater in unterhaltenden Anekdoten vor unseren Augen erscheinen, während der Sohn des einen Regisseurs nur noch vage Erinnerung an das Haus umreißen kann. Man spürt das Verbleichen der Erinnerung von Generation zu Generation.
Einmal wird ausformuliert, wie Erinnerung funktioniert. Durch Assoziation: Der Regisseur setzt sich in ein Café um die Ecke des Hauses. Erst als er nach einer halben Stunde bemerkt, dass er nicht bedient wird, erinnert er sich, dass die Besitzer des Cafés mit seiner Familie einst in einer regelrechten Fehde verwickelt waren. Dem wird nachgegangen. Die Geschichte folgt.
Als Leitmotiv sehen wir einen der Regisseure mit einem Metalldetektor beim Versuch, einen versteckten Schatz im Haus zu finden. Angesteckt durch eine beiläufige Bemerkung des Vaters begibt er sich auf die Suche. Er wird nicht fündig. Er kommentiert dies stets lakonisch aus dem Off, erzählt das Gezeigte gleichzeitig selbstironisch nach. Ein Zufall führt schließlich seine Mutter zu dem versprochenen Schatz. Mit einem Metalldetektor unmöglich zu finden, denn es sind bare Geldscheine.
Das Haus wird von der Familie leergeräumt und steht nun zum Abriss bereit. Die Verbliebenen fragen sich, was nun mit dem Grundstück passiert. Niemand ist glücklich, dass ein Parkplatz dort entstehen soll.
Wir fliegen vom Ort weg. Während der Abspann läuft, sehen wir rückwärts den Abriss. Vor unseren Augen baut sich von der Ruine bis zum festen Gebilde das Haus wieder auf.
Es ist ein Film über Erinnerung. Über deren stete Veränderung, Fehlbarkeit und Lebendigkeit.
(Nicolai Zeitler)
Wir befinden uns mitten in der Dunkelheit eines nächtlichen Waldes. Mit Hilfe der Scheinwerfer eines Autos begeben wir uns auf einen Weg in eine Ruine. Im Tessin in der italienischen Schweiz.
Von außen betrachtet ist es ein altes und verlassenes Haus, dunkle Schatten an der altweissen Fassade geben Hinweise auf einen Brand. Dieser liegt 20 Jahre zurück. Solange hat niemand das Haus betreten, das vor vier Generationen von italienischen Einwanderern bewohnt wurde.
Wir betreten das zerstörte Herzstück des Hauses, wo sich die Hinterlassenschaften eines fluchtartig verlassenen Lebens befinden. Als sei man bei der Durchschreitung der verformten, bruchreifen Haustür in einer Zeitmaschine mehrere Jahrzehnte zurück gereist, findet sich hier ein kompletter, einst gutbürgerlich gehegter Hausstand.
Es beginnt die Suche nach einem Schatz, der hier, in der Familie von Generation zu Generation weitergetragen wurde, irgendwo verborgen liegen soll.
Zeitgleich werden auch die immateriellen Spuren der Menschen gesammelt, die hier jahrzehntelang wohnten. Es beginnt eine Auseinandersetzung mit dem Wert – dem Wert der Erinnerung und dem Wert des Materiellen. Kirche, gutbürgerliche Sitten und der Wunsch nach zur Schau gestelltem Ansehen verflechten sich in Erzählungen und durch das Betrachten des Besitzes ineinander. Mit poetischen Texten, die das Entdecken der Fundstücke ergänzen, werden wir darauf aufmerksam gemacht, welche Bedeutung Besitz in der Welt des einzelnen einnimmt. Von was werden wir eingenommen, was macht der Wunsch mit uns, Dinge zu besitzen?
Das Haus wird nun abgerissen, die Suche nach dem Schatz eilt. Schicht für Schicht wird das Haus abgetragen. Wir erfahren mehr aus dem Inneren der Familie und stoßen auf Leerstellen. Dinge, die im verborgenen der selbsterbauten familiären Festung blieben, kommen zum Vorschein. In der Vorstellung des Zuschauers beginnen die Familienangehörigen auf den Fotos eine reale Form anzunehmen.
Die Identität als Migrant zu dieser Zeit, in Abkehr vom italienschischen Faschismus wird hier, in dieser schweizerischen Idylle, greifbar.
(Lene Vollhardt)
CIGARETTA MON AMOUR, eine dokumentarische Miniatur von Rosa Hannah Ziegler (KHM)
In dem schwarzweißen Film „Cigaretta mon Amour“ von Rosa Hannah Ziegler, beobachten wir einen Mann in seiner Wohnung. Es scheint als gäbe es nur ein Zimmer. Es ist in Wohn- und Schlafbereich unterteilt und hat an einer Seite eine lange Fensterfront. Das erste Bild zeigt eine Makroaufnahme seiner Haut, man sieht wie er sich eine Zigarette dreht. Der Mann sitzt in seinem Bett und raucht, über ihm eine Rauchwolke. Die Kamera begleitet ihn von Zigarette zu Zigarette. Er wirkt krank und zerbrechlich, wenn er sich rauchend durch das Zimmer bewegt und den Garten, als wäre er unfreiwillig eingeschlossen, durch das Fenster betrachtet. Schnitt. Die Kamera ist draußen, beobachtet diesen alten Mann, der hinter dem Fenster steht, sich den Garten ansieht. Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Gleich danach sind wir zurück in der Wohnung. Stille. Kein Vogelzwitschern, keine Sonne die scheint. Es gibt nur den stillen Raum und diesen starren, nachdenklichen, gebrechlichen Mann. Er schließt den Vorhang und legt sich mit einer Zigarette wieder ins Bett.
(Rebecca Hirneise)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ruhige, recht stille Film aus vielen kontrastreichen,
atmosphärischen Bildern besteht, die einem zu verstehen geben, dass es sich hier um einen Mann handelt, dessen Liebe zur Zigarette gleichermaßen zu seinem Verhängnis geworden ist.
Er scheint so vor sich hinzuleben, nur noch der Zigarette wegen zu existieren.
Bei dem alten Mann handelt es sich um den Zigarettenabhängigen, schwer kranken Vater der Filmemacherin.
(Dominic Thiel)
VON DER VERMÄHLUNG DES SALAMANDERS MIT DER GRÜNEN SCHLANGE von René Frölke
D 2010 | Farbe | 94 Min. | Uraufführung
Es dauert zwei Minuten, bis wir Jürgen das erste Mal von vorne sehen. Vorher sind wir ihm mit der Kamera gefolgt, mit ihm durch die Straßen gegangen. Jetzt sitzt er an einem Schreibtisch und malt, mit wachem und konzentriertem Blick. Neben sich hat er mehrere große Taschen, gefüllt mit Filzstiften. Das Sofa zieren Plüschtiere, an der Wand hängt ein Kruzifix. Wir schauen ihm über die Schulter, wie er mit einem schwarzen Tintenroller das Papier füllt. Es entsteht eine Mauer und auf der Mauer eine schöne junge Frau.
Durch die großen Fenster im Hintergrund ist das Meer zu sehen. Vor den Fenstern stehen ein Sofa und ein Sessel, darauf Jürgen und seine Mutter. Er liest in einer Zeitung, sie stickt. Sie bemerkt, dass sie ihre Schere vergessen hat, ihr Sohn bestätigt es ihr und steht auf, um sie ihr zu bringen. Danach setzt er sich wieder auf die Couch und liest weiter.
Die Mutter sitzt uns gegenüber und erzählt von der Vergangenheit. Von einem großen Haus mit Hausmädchen und dass alles besser war, bevor sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern herkam.
Jürgen wischt die Strandterrasse. Er trägt Arbeitskleidung. Wir beobachten, wie er den Wischmob über die Fliesen fahren lässt. Er arbeitet langsam und konzentriert, als wäre der Besen ein Pinsel und der Boden aus Papier. Danach sitzt er auf der Terrasse und malt. Bei ihm stehen drei Kinder und stellen ihm Fragen zu seinem Bild. Er schaut kaum auf und sagt nur wenig.
Im Haus, in dem Jürgen mit seiner Mutter und seinem Vater eine Etage bewohnt, hängen über die Flure verteilt 76 Bilder, die Jürgen gemalt hat, verglast und gerahmt. Er durchquert das Haus mit einer jungen Frau und beschreibt ihr seine Art zu Malen, immer mit Filzstiften, spontan und „aus dem Kopf heraus“. Seine Sprache ist einfach und die Formulierungen ungeschliffen. Nach einiger Zeit kommt die Mutter hinzu und erklärt der Frau, dass ihr Sohn eine starke geistige Behinderung habe, und er nicht wisse, ob seine Bilder irgendeine Bedeutung haben. Das hat die Frau nicht gewusst. Dann geht die Mutter wieder, und Jürgen und die Frau schauen sich weiter Bilder an. Ein Schiff auf dem Meer, ein blauer Himmel mit weißen Wolken und das Brandenburger Tor.
Jürgen hält ein Bild in den Händen, das er aus dem Keller geholt hat, und das nun in der Wohnung hängen soll – sein erstes selbst gemaltes Bild. Der Name, mit dem das Bild signiert ist, ist jetzt nicht mehr sein Name. Seine Eltern haben ihm, als er 15 war, erzählt, dass sie nicht seine leiblichen Eltern wären, und sie seinen Nachnamen geändert haben, als er sechs Jahre alt gewesen war. Da hatte er seine Lebenserwartung bereits überschritten. Jetzt ist er 33.
Zum zweiten Mal sitzt uns Jürgens Pflegemutter gegenüber und erzählt aus ihrer Erinnerung. Damals war sie in Paris gewesen. Da hatte sie Modelmaße gehabt und die Chance, Karriere zu machen, was ein Klumpfuß, die Folge ihrer Kinderlähmung, verhindern sollte. Später erzählt sie von Jürgen. Wie sie über das Radio von ihm erfahren haben und das große Experiment eingingen, seine Pflegeeltern zu werden. Und davon, dass er ein furchtbar schwieriges Kind war und jetzt der beste Sohn, den man haben könne.
Es ist Karneval und Jürgen verkleidet sich als Clown. Das Wohnzimmer ist geschmückt mit Girlanden, und es steht zu trinken und zu essen bereit. Seine Mutter ist noch nicht da, die Übertragung des Kölner Rosenmontagzugs bietet Ersatz.
Eine Ausstellung von Jürgens Bildern. Er ist fröhlich und genießt die Anwesenheit der vielen Leute, die nur seinetwegen dort sind, die er jetzt kennen lernt. Er unterhält sich und lacht mit ihnen. „So führe ich ein normales Leben, wie jeder andere Mensch auch.“
(Robert Hamacher)
Wir sehen ein nächtliches Feuerwerk, Slow-Motion, hören melancholische Musik.
Anschließend folgen wir einem jungen Mann mit einem etwas zu stramm angezogenen Rucksack auf dem Rücken. Wir sehen ihn von hinten, wie er durch die Straßen schreitet. Es bleibt haften, dass er für das Überqueren eines Zebrastreifens seine volle Aufmerksamkeit braucht. Er führt alle angelernten Schritte durch, schaut nach links, nach rechts, vergewissert sich, dass der Autofahrer ihn gesehen hat und läuft dann los.
Wir sehen ihn zu Hause mit seiner Mutter, vor allem sehen wir ihn malend. Er malt Muster und Strukturen. Wir beobachten, wie er die ganze Konzentration auf seine Motorik legt, den ungeteilten Fokus auf die Ausführung der Bewegungen seiner Hand und Finger.
Seine Mutter berichtet von ihrer Vertreibung, damals, wie sie mit ihrer Mutter und den anderen Geschwistern fliehen musste und sie nicht genug zu essen hatten.
Wir sehen den jungen Mann, er heißt Jürgen, bei seiner Arbeit am Ostsee-Strand. Er fegt und wischt das Strandklo.
Durch die fragmentarische Erzählform des Films, in der einzelne Aspekte des Lebens von Jürgen gestreift und angedeutet werden, auf den Zuschauer und dessen Mitarbeit vertraut wird, entsteht ein Bild von Jürgen. Durch ein Gespräch mit einer Frau während seiner Arbeit formt sich eine Vermutung: Jürgen ist geistig zurückgeblieben. Dies bleibt jedoch unausgesprochen über den Bildern, bis die harte Realität ausgesprochen wird: Eine Künstlerin aus Holland interessiert sich für Jürgens Malerei und versucht sich mit ihm auseinander zu setzen, stößt jedoch in puncto Intention und Interpretation bei ihm an Grenzen. Dann taucht Jürgens Mutter auf und gibt der jungen Frau zu verstehen, dass man Jürgen nicht ernst nehmen könne. Er sei geistig schwerstbehindert. Er verstünde nicht, was sie meine. Eine Szene, in der Jürgen vor der jungen Frau und vor uns demontiert wird, aber dies selbst gar nicht so empfindet. Er wiederholt die Worte seiner Mutter, dass er ja wirklich nichts verstehen würde. Von außen wirkt es zunächst absurd, jedoch stellt sich bald die Frage, ob der Umgang zwischen Mutter und Sohn so ehrlich und hart sein muss, damit dieses Thema nicht über ihnen wie ein Tabu schwebt.
Jürgen erzählt von seiner Kindheit. Er wurde als Pflegekind von seinen jetzigen Eltern adoptiert, war geschockt, als ihm dies mit sieben offenbart wurde. Seine Mutter erzählt von ihrer Zeit als junge Frau. Damals in Paris.
Frölke, der Regisseur, lässt die Personen reden. Mitunter wirft er Bemerkungen ein, den Erzählfluss nicht abreißen zu lassen, durch offen gehaltene Fragen oder Wiederholung des letzten Satzes, Räume zu öffnen. Anders bei der Mutter. Sie berichtet von ihrer Zeit in Paris, er forscht nach, will wissen, was sie damals genau gemacht hat, an welchen Orten sie verkehrt hat. Es bleibt das Gefühl, dass sie damals, anders als sie es tatsächlich empfand, eine naive junge Frau war.
Dann erfahren wir von Jürgens Kindheit, vor allem jedoch, was diese Kindheit für seine Mutter bedeutet hat. Als hyperaktives Kind war er nur schwer zu bändigen und musste ununterbrochen unter Beaufsichtigung sein. Er war sehr anstrengend bis zur Pubertät, wo er mit einem Mal zum ruhigsten Menschen wurde, den man sich vorstellen kann.
Und Jürgens Mutter erzählt von ihrer Mutter. Wir spüren eine große Verletzung durch das schwierig Verhältnis. Sie wurde von Anfang an verstoßen und niemals als Kind angenommen.
Warum sie sich mit der Adoption von Jürgen, einem in die Gesellschaft vollkommen Unintegrierbaren, eine so große Bürde aufgelastet hat, bleibt als Frage. Ihre Verbitterung und Härte einerseits und ihr deutlicher Altruismus ergeben einen Widerspruch, der nicht aufgelöst wird und nicht gelöst werden muss. Danach gefragt, sagt sie, sie sei ein Experiment eingegangen. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ist daran gewachsen.
Es zeichnen sich im gesamten Film Aspekte aus dem Leben der Mutter ab, die es Wert wären, weiter untersucht zu werden. Der Film bleibt offen, lässt die Lücken.
Es gibt ein bewegenden Moment: Jürgen berichtet von seinem besten Freund, auch geistig behindert, der im Alter von 10 Jahren starb. Sowieso starben alle mit einer ähnlichen Beeinträchtigung kaum dass sie erwachsen wurden mit Anfang 20. Jürgen ist 33. Er ist sich sicher, er wird uralt. Und er wird ein normales Leben führen, wie alle anderen Menschen auch. Nach diesem Satz, schaut er für einen kurzen Moment in die Kamera und bewegt sich nach vorne um etwas zu greifen, als würde er diesen Satz nicht hinterfragen wollen. Dem wird hier nicht weiter nachgegangen. Schnitt.
(Nicolai Zeitler)
Jürgen malt die Fantasielandschaften aus seinem Kopf. Früher mit Fingerfarben, heute mit Farbstiften. Ornamentale Formen und Staffelung sind seine Stilmittel und auch eben nicht, er denkt ja nie nach beim Malen. Die Bilder kommen einfach so.
In einem Altersheim in Glücksburg bekommt eine ausländische Künstlerin eine exklusive Führung durch Jürgens Werk. Sie mag die Farben und die Form. „Er versteht ihre Fragen nicht. Er kann das nicht verstehen. Jürgen ist behindert. Man merkt es oft nicht, aber er ist behindert. Sie verstehen - mental disease.“ Auf diese Aussage von Jürgens Mutter weiß die Künstlerin nun absolut nicht zu reagieren.
Immer noch paralysiert bekommt sie auch schon weiteren Input von Jürgen. Um ein Bild mit dem Motiv des Brandenburger Tores und der Berliner Mauer geht es. Gezeigt wird das Bild aber nicht, und hier offenbart sich die Essenz des Filmes, die Sprache.
Hat die Mutter recht mit ihrer Aussage über Jürgen oder degradiert sie ihn, macht sie ihn behinderter als er ist?
Jürgen wurde als behindertes, jedoch förderbares Kleinkind adoptiert. Dabei mochte seine Pflegemutter ihn nicht besonders und wurde auch nicht froh mit ihm. Jürgen, der als Kind mehrere Familien durchlief, war bis in die Pubertät ein behinderter Schwerfall. Ohne Ruhe und Fokussierung machte er seinen Pflegeeltern das Leben zur Tortur. Nun ist Jürgen 33 Jahre alt und scheint in jeder Lebenslage einen in sich gekehrten Ruhepunkt zu bilden. Wie stehen wir nun also zu der Aussage der Mutter?
Sicherlich kennt sie ihren Sohn, den sie und ihr Ehemann trotz aller Strapazen aufgezogen haben, besser als besagte Künstlerin, als wir, die ohne Ausnahme etwas entsetzten Zuschauer. Bekommt Jürgen nicht, was er verdient? Wir alle wünschen ihm doch Erfolg und Respekt, die Realität setzt sich jedoch über das Gutmenschentum hinweg, Jürgen malt aus kindischer Naivität heraus und beabsichtigt keine Interpretation im Sinne künstlerischer Referenzen – und das ist alles andere als Negativ. Jürgen muss nicht romantisiert werden und braucht keinen bohèmen Hintergrund. Er muss kein verstecktes Genie sein, um wahrgenommen zu werden.
Es geht um die Dekonstruktion gewohnter Begriffe, um die Variabilität der Sprache. So folgt die Kamera Jürgen und seiner Familie, lässt viele Fragen offen und schneidet Vieles an. Es entsteht ein Portrait der Familie, deren Geschichten in kurzen Momenten angedeutet oder ausgesprochen werden, aber nie zu Ende gesponnen werden/können. Was Übrig bleibt, könnte ein erahnter Konsens genannt werden, wie das eben so ist in der Realität.
(Philipp Ernst)
Ein Feuerwerk über einem dämmernden Horizont, gleich am Meer. Nichts außergewöhnliches, würde man denken, wäre da jedoch nicht eine Eigenheit, welche die Sicht des Zuschauers irritiert - denn das Feuerwerk verläuft invertiert, es scheint als explodiere es nach innen.
So beginnt der Film. Mit der Innensicht eines Künstlers der sich durch eine kleine, manchmal kaum sichtbare Eigenheit maßgeblich von den anderen unterscheidet - denn er ist von Geburt an mental gehandicapt.
Wir folgen der raschen, sicheren Stiftführung über dem Papier. Es sind naiv gezeichnete und klare Konturen der Umgebung, in der er lebt, in einem Touristenörtchen am Meer, umgeben von Natur, aber manchmal eben auch in einer Welt, die nur er in Gedanken betreten kann. Die Anerkennung, die dieser Künstler nun innerhalb der Kunstkreise erhält, scheint ihm nicht schon immer zu Teil gekommen zu sein.
Seine Mutter Trude offenbart, dass die ihn zu Beginn der Adoption gehasst habe. Ihr Mann habe sie dazu überredet, den Jungen aufzunehmen. Die Unentschiedenheit dieser beliebigen Familienzusammenführung erscheint zunächst erschütternd.
Bald jedoch erfährt der Zuschauer, wie Edeltrauts Leben selbst von menschlichen Abgründen und Schicksalsschlägen gezeichnet wurde. Der Abstecher in die Pariser Welt der Bohèmiens scheinen sie maßgeblich geprägt zu haben – sie redet gern darüber. Trotz allem entscheid sie sich eines Tages dagegen und kehrte ins biedere deutsche Leben zurück, um „gute Dinge“ zu tun. So sei sie nun einmal.
Nach und nach erschließt sich die von Komplikationen durchzogene Geschichte zweier Menschen, die von einem fast unbeteiligt erscheinenden Dritten zueinander geführt werden - dem Ehemann und Vater Günter.
Es ergibt sich, letzten Endes, eine interessante menschliche Konstellation und ein überraschend funktionierendes Familiengefüge.
(Lene Vollhardt)
Einer nach dem anderen decken die Striche die Fläche eines weißen Blattes. Die Striche werden Ziegel, die Ziegel ein Dach, das Dach ein Haus. Die Tinte befeuchtet das Papier, das nun mit Farben prahlt. Himmelblau, Grasgrün, Sonnengelb. Seit Jahren malt Jürgen Landschaften und Wesen mit farbigen Filzstiften. Wie diese Bilder entstehen, kann er nicht erklären. „Das kommt einfach raus bei mir“, sagt er.
Er wurde als Kind zur Pflege freigegeben. Als geistig Behinderter hätte er laut der Ärzte mit sechs Jahren sterben müssen. Nun ist er dreiunddreißig und zeigt seine Bilder in einer Ausstellung. Er werde uralt, sagt er entschlossen, als ob es etwas wäre, was man sich vornehmen kann. Und man glaubt es ihm.
Seine „innere Traumwelt“, wie er es zu nennen pflegt, vermag es, das Weiße eines Blattes vollständig abzuschaffen. Ebenso minutiös wie er den Boden wischt. Strich um Strich wird von ihm das Wasser auf dem Boden verteilt, wie die Tinte auf dem Papier. Keine weiße Lücke wird hier hinterlassen, der Film dagegen weist einige auf. Lücken in Form von Toren zu anderen Geschichten dieser Familie, zu den verborgenen Fäden in dem Gewebe des Erzählens. Die Jugendzeiten der Pflegemutter im Paris der sechziger Jahre und die Beziehung zu ihrer eigenen Mutter. Der Vater, eine stille, einsam wirkende Figur in dem Film, hört das Lied der Fremdenlegion auf Youtube.
Einzelne Momente zeigen die Fähigkeit des jungen Filmemachers mit dem Ton bewusst zu intervenieren. Wie die Aufnahme an diesem Ostseestrand, wo der Gesang der fernen Möwen die verlassenen Schwanenboote begleitet, oder wo die Ruhe von dem lauten Geräusch eines Rasierapparates unterbrochen wird. Besonders bezeichnend hierfür ist aber eine Szene, in der Jürgen sich verkleidet und eine Party organisiert. Hier wird auf den Originalton verzichtet und stattdessen hört man die beunruhigende Komposition Elliot Carters, in der die Flöte Versuche unternimmt, sich dem Streichinstrument anzunähern. Die mögliche Harmonie dieses Familientreffens wird so gebrochen.
Der Film endet mit einer schönen Aufnahme. Ein Plastikfloß in der Mitte des Bildes, auf diesem zwei Männer. Der eine wirft sich ins Wasser, der zweite nimmt lieber die Treppen. Der Film funktioniert über Analogien, wie der Reflex des Fußballtores im Wasser, das ein weißes Quadrat darin bildet. Eine geschlossene Figur wie die Geschichte dieser Familie, aber kein Kreis der Wiederholung. Denn obwohl Jürgens Mutter anfangs ihren Sohn nicht mochte, so wie sie von ihren eigenen Mutter zurückgewiesen wurde, liebt sie ihn nun wie einem Sohn, den man sich nicht besser wünschen kann. Die Quadratur des Kreises.
So wie die Schlange des Titels, der aus einer Erzählung von E.T.A Hoffmann stammt, ist das Künstlerische etwas Vielgestaltiges, Polymorphes. Eine Waffe gegen die Versteinerung durch den Verstand, die wieder das Leben zur Verflüssigung bringt. Der Film ist ein Gesang auf die Phantasie.
(Laura Morcillo)
NACHTSCHICHTEN von Ivette Löcker?
A 2010 | Farbe | 97 Min. | Uraufführung
Auf einer schwarzen Leinwand werden langsam die Konturen eines Waldes sichtbar, beleuchtet durch einen tief fliegenden Jet. Die Kamera schwenkt mit dem Flugzeug mit, entlässt es aus der Quadrage und bleibt auf dem Bild des schwarzen Nachthimmels stehen. Ein Jäger lädt sein Gewehr, setzt sein Fernglas an und visiert einen Punkt dicht neben der Kamera. Fenster werfen verzerrte Lichtflecke auf eine dunkle Wohnung. Die Autorin spricht von der Erinnerung an ihre Wahrnehmung der Nacht, wenn sie als Kind nicht schlafen konnte.
Die Kamera folgt in kurzen Episoden Menschen, Einzelgängern und Gruppen, durch das verschneite nächtliche Berlin. Jägern und Gejagten, Streunenden, Getriebenen, Zuflucht Suchenden.
Ihre nächtlichen Tätigkeiten werden gezeigt, mehr angedeutet als erzählt. Sie laufen, fahren und fliegen durch die Nacht, die Kamera folgt ihnen unaufdringlich. Wildschweine, Graffitis und Knieprobleme konstruieren Brücken zwischen den Portraitierten. Sie bewegen sich fremd und isoliert - mehr noch durch Kälte als durch Dunkelheit - in ihrer Umgebung, genauso anonym bleiben sie auch dem Betrachter.
Durch den Ton wird versucht, Nähe zu erzeugen. Ansteckmikrofone machen das Frieren hörbar. Und das Einreden auf Hunde, Enten, Diktiergeräte und die Regisseurin.
(Florian Haag)
Im Dunkel der Nacht, ein Großstadtportrait, das die Schlaflosigkeit seiner Bewohner begleitet.
Episodenhaft erzählt der Film von Menschen im verschneiten Berlin. Die Figuren bedienen sich der Dunkelheit. Der Jäger, gleich zu Beginn des Films, findet seine Beute nur zu dieser Tageszeit, zwei Graffitisprüher können nur im Dunkeln agieren. Ihr Ziel ist ein Zug. Die Gegenspieler, Polizisten der Flugwache, lernen wir bei ihrer nächtlichen Helikoptersuche nach illegalen Sprühern kennen. Sie finden die, die sich im Dunkel verstecken. Zwei Frauen der Berliner Stadtmission klappern mit dem Kältebus die Stadt nach Obdachlosen ab, sie an warme Orte zu bringen. Eine Frau arbeitet als Nachtwache auf einer Containerverladestation. Ihr Hund, ihr Begleiter, bewacht das Gelände. Eine junge Frau aus Japan bastelt Schmuck aus Audiosteckern und legt in Clubs als DJ Platten auf.
In der Exposition werden die Figuren und ihre Tätigkeiten vorgestellt, im Hauptteil vertieft. Man erfährt von den Protagonisten, von deren Stimmen aus dem Off, die Beweggründe.
Zwei Figuren tauchen erst in der Mitte des Films auf. Die Geschichte der Stadtmission führt uns zu einem Obdachlosen auf der Suche nach einem Schlafplatz. Er verrät seine Tricks, keine Spuren zu hinterlassen, und erzählt von seiner Vergangenheit. Ein junger Mann, der durch eine Kreuzbandoperation seine Wohnung nicht verlassen konnte und sich zudem allein wohler fühlt als in Gesellschaft, verbringt seine Freizeit damit, durch die Nacht zu laufen und das erlebte auf Tonband festzuhalten. Er ist der einzige Protagonist, der auch in seiner privaten Umgebung gezeigt wird. Er ist umgeben von Zitaten an seinen Wänden.
Wo zu Beginn des Films Szenengeräusche dominieren, gewinnt die Sprache mit zunehmender Annäherung an die Protagonisten an Dominanz. Die Figuren erzählen von sich. Einzelne Episoden werden durch Tonüberlagerungen verzahnt. Der Graffitisprüher spricht über das Anpirschen eines Fuchses an einen Hasen, während die Polizei im Hubschrauber mit Nachtsichtgerät auf Kriminelle lauert.
Durch inhaltliche Analogien der Episoden gelingt eine Kontinuität, die stellenweise witzig ist. So sehen wir die Polizisten im Hubschrauber sitzend, verkabelt und vernetzt, mit optischer Hilfsapparatur und ausnahmslos abhängig von moderner Technik, welche im Kommentar der nächsten Szene durch die Securityfrau zunichte gemacht wird. „Die Technik kann nicht alles, die kann nicht losrennen.“ Sie meint ihren Hund.
Der Film endet mit dem „Feierabend“ der Nachtmenschen. Schichtwechsel, der Tag beginnt.
(Heidi Herzig)
Die Scheinwerfer eines Flugzeuges, das in die Nacht hinein fliegt. Licht fällt auf das Auge eines Mannes, der ein Gewehr lädt. Lichtmuster, die von der Straße auf eine Wohnungswand scheinen, Lampen, die aus dem Boden in den Raum zu wachsen scheinen. Die Kamera schwankt, bis sie auf dem Kopf steht. Aus dem Off erzählt uns eine müde Frauenstimme von ihren schlaflosen Nächten als Kind.
Ähnliche traumartigen Sequenzen tauchen erst in der Mitte des Films und am Schluss wieder auf. Dann gleitet ein weiteres Flugzeug auf eine Landebahn. Dazwischen streifen wir in verschiedenen Episoden durch das nächtliche, schneebedeckte Berlin:
Zwei Gestalten schleichen sich an stillstehende Bahnwaggons heran und besprühen diese hektisch mit Spraydosen. Sie haben Kapuzen auf, ihre Gesichter sieht man nie. Ihre Stimmen lassen sich schwer verorten. Sie sind sehr klar, klingen nah und isoliert von der Umgebung, so dass ich mir erst nicht sicher bin, ob die Männer Ansteckmikrofone tragen oder ihre Stimmen aus dem Off kommen.
Durch die Scheibe sehen wir ein Polizeibüro. Wie in einem Action-Film wird der Einsatzhubschrauber hergerichtet: in kurzen, relativ schnell aufeinanderfolgenden Sequenzen, die in einem Nachtflug über der Stadt enden.
Die Kamera folgt zwei Frauen, die auf Grund des Eises einer ständigen Rutschgefahr ausgesetzt sind. Auch bei diesen beiden Frauen, sowie in allen weiteren Episoden, dominieren die Stimmen den Gesamtton. Die Umwelt – eine Taschenlampe bestimmt, was aus dem dunklen Ganzen zu sehen ist – wirkt seltsam entrückt. Die beiden Frauen fahren den „Kältebus“ und kümmern sich um Obdachlose, indem sie ihnen versuchen eine Unterkunft zu beschaffen. Eine auf der Straße aufgeschnappte Frau wird betreut. Sie kommuniziert mehr mit der Regisseurin als mit den Betreuerinnen. Scheinbar ohne dass ihr Fragen gestellt werden, erzählt sie von ihrer Situation. Die Betreuerinnen gehen mit der Frau in ein Gebäude, die Kamera bleibt vor dem Tor stehen.
In der Polizeiwache spricht eine Polizistin mit ihrem großen, schwarzen Hund. Später erzählt sie der Regisseurin (die niemals mit im Bild ist) Anekdoten von „Dienstvorfällen“ und über die Wichtigkeit des Personeneinsatzes, denn „Technik könne nicht los rennen.“
In der Wohnung einer japanischen Frau, können wir dieser zuerst beim Lesen, beim Schmuck machen (Ohrringe aus Kabelsteckern) und dann beim Anhören und Markieren ihrer Vinyl-Platten sehen. Mit der Regisseurin redet sie über ihre Arbeitsweise als DJ und über ihre Wahrnehmung der Nacht.
Ein Mann spricht in seiner Wohnung über sich als „Nachtwanderer“. In einer kurzen Kamerafahrt streicht die Kamera über eine mit Sprichwörtern und Lebensweisheiten bezettelte Wand. So ähnlich klingen auch die Sätze, die der Mann bedeutungsschwer und mit Unterbrechungen in sein Diktiergerät spricht. Später läuft er durch menschenleere Straßen und spricht über das Alleinsein.
Die Innenaufnahmen sind ausschließlich statisch und wirken geplanter, komponierter als die Außenaufnahmen, in denen die Kamera flexibler sein muss und so überwiegend von Hand gehalten wird.
Die einzelnen Episoden mit ihren jeweiligen Protagonisten werden parallel zueinander erzählt, die Schnittstellen mal explizit, mal lose miteinander verbunden. So kann man bei den Sprayern von einer Gegenüberstellung sprechen, wenn auf deren nächtliche Aktivitäten die Überwachungskameras der Polizisten folgen, die stellenweise nur der Prävention des Sprühens zu dienen scheinen. Unterstrichen wird dieses Spannung erzeugende Mittel durch eine Anekdote des leicht paranoiden Sprühers, die von Hasen, Füchsen und Jägern handelt. Seine Offstimme geht über in die Aufnahmen der Infrarot-Kamera des Überwachungshelikopters, der damit die Straßen unter ihm erschreckend detailliert aufzeichnen kann. Wer hinterlistet nun wen?
Berlin von oben. Der Scheinwerfer des Helikopters strahlt auf einen stehenden ICE. Die Infrarot-Kamera entdeckt einen Körper auf den Schienen. Man spricht von Selbstmord. Dieser Vorfall leitet die Mitte des Films ein, die gekennzeichnet ist durch ein Rückgriff auf das„Traumhafte“: Wie im Prolog werden Ton und Bild abstrakter. Leere Straßenzüge, flackernde Straßenlampen, Schneeflocken. Wind, Stille, ein wabernder und sich ausbreitender Ton, Schnee, der auf den Lampen zischend schmilzt.
In der zweiten Hälfte des Films nehmen die eingeführten Episoden ihren Lauf. Die Dominanz der Ansteckmikros nimmt wieder Oberhand. Die Bilder verlieren wieder an Räumlichkeit. Tendenziell kommt der Ton nun verstärkt aus dem Off. Wir sehen die Protagonisten durch die Nacht laufen, in der U-Bahn, vor der Essensausgabe. Wir hören persönliche Episoden aus ihrem Leben, Ansichten und Träumereien. Und obwohl Fragen von der Regisseurin auszugehen scheinen, so wirkt das Filmteam doch sehr passiv. Es lässt sich von den Protagonisten führen, die sich vor der Kamera selbst inszenieren: Der Sprayer hinterlässt seine abenteuerlichen Spuren an einer schwer zu erreichenden Hausfassade. Die DJane legt in ihrem Club auf. Der Nachtwanderer spricht Lebensweisheiten in sein Diktiergerät. Ein Obdachloser führt uns zu seinem geheimen Schlafplatz, eine Tiefgarage. Die Filmemacher unternehmen nicht den Versuch, an diesen geschaffenen Selbstbildern zu rütteln, zu widersprechen oder nachzufragen. In diesen spürt man eine gewisse Eitelkeit und eine damit zusammenhängende Künstlichkeit. Die Protagonisten erscheinen trotz interessanter Lebenslage doch eindimensional.
(Iuri Maia Jost)
Stille… Dunkelheit… Es ist Nacht. Ein Lichtpunkt wird zwischen als Silhouette erscheinendem Geäst sichtbar. Langsam wird ein Brausen hörbar, welches mit dem sich nun nähernden Licht stetig ansteigt.
Relativ schnell erkennen wir dieses Licht als Flugzeug, welches gerade von einem Flugplatz gestartet ist, und den Ursprung des Brausens in den dazu gehörigen Turbinen. Ganz in der Nähe: Das Gesicht eines Mannes, nur spärlich beleuchtet. Wir erkennen ihn als Jäger anhand seines Gewehres, welches er mit Patronen lädt. Es ist kalt… Es ist Winter… Es liegt Schnee… Er wartet…
Mit diesen Bildern beginnt der Film “Nachtschichten“ von Ivette Löcker.
In verschiedenen Episoden, die in Form einer Parallelmontage erzählt werden, lernen wir verschiedene Charaktere kennen, für die das winterliche Nachtleben in Berlin viel mehr bedeutet als der Tag, an dem sie unterzugehen oder nicht richtig zu existieren scheinen. Des Nachts erwachen sie zum Leben.
Ein Grafitti-Künstler, der stark vermummt, in eine dicke Winterjacke eingepackt, mal allein, mal im Team mit einem Kollegen Bahnwaggons besprüht und von Dächern aus, nicht ganz ohne Risiko, Häuserwände bemalt.
Die Beamten der Bundespolizei, die sich mittels Hubschrauber, ausgestattet mit Wärmebildkameras, auf die Jagd nach Straftätern der Nächte machen.
Zwei Frauen der Berliner Stadtmission mit einem Lieferwagen, mit dem sie Obdachlose in kalten Nächten von den Straßen auflesen und ihnen Übernachtungsmöglichkeiten anbieten.
Ein Obdachloser auf der Suche nach einem Schlafplatz. In einer Parkhaushalle wird er fündig und richtet sich seinen Platz ein, indem er ihn mit ausgefeilter Technik mit Zeitungspapier auslegt.
Eine Frau, die ihre Nachtschicht als Sicherheitsdienst einer Industrieanlage tätigt.
Ein an Diabetes erkrankter, arbeitsloser Mann, der als Nachtwanderer durch die Straßen Berlins spaziert und eine Japanerin, die sich als DJ betätigt und von jeglicher Art elektronischer Stecker fasziniert ist.
Alle Figuren erzählen von persönlichen, oft tragischen Erlebnissen, von Arbeitstechniken und Überlebensstrategien.
In sehr kontrastreichen Bildern, in denen die Dunkelheit der Nacht dominiert, werden in diesem Film grundsätzlich verschiedene Individuen der Nacht, Außenseiter der Gesellschaft, auf ihren Wegen durch das verschneite Berlin begleitet. Die letzte Szene führt uns zum Anfang des Films. Ein Wildschwein streift durch den Wald, beobachtet den schon bekannten Jäger. Ganz in der Nähe landet ein Flugzeug auf einem hell beleuchteten Rollfeld.
(Dominic Thiel)
